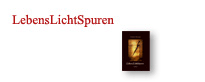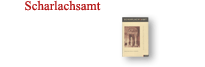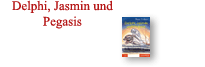Auszüge aus einer Lesung

Unsere Geschichte beginnt im fernen Griechenland vor neun Jahrhunderten. Ein verzweifelter Mann stapft den verschneiten Olymp hinauf. Er sucht nach den Göttern, deren Oberster ihm einst eine entsetzliche Strafe auferlegt hat. Doch die Götter sind verschwunden mit der griechischen Kultur untergegangen. Wer ist jener Gipfelstürmer?
Stein der Erkenntnis
Nackt, sonnenbedeckt
lag ich Lorbeerbekränzter
am Gestade
der Landenge,
stark, selbstsicher
an Körper und Geist.
Übermut, Lebensfreude
zierten meine Tage.
Feinden und Göttern
trotzte ich König
von Korinth.
Du lächeltest mir zu
verführerische Muse
und umspieltest
mein Gemüt.
Asophos, dem Flussgott,
im Streit mit Zeus,
verriet ich
für sprudelnd Wasser
aus kargem Felsen
Gottvaters Versteck.
Da sandte mir
gewaltiger Zeus
den Tod,
den Schrecklichen,
auf staubiger Straße
von ferne erkannt.
Furchtlos band ich ihn
in Stricke.
Welt und Tod
traten still
für eine Weile.
Zeus strafte mich
übermütigen Mensch.
Ares selbst
schillernder Krieger,
befreite den Tod,
erschlug mich.
List im letzten Gepäck
fuhr ich zum Hades.
Gattin, sprach ich zuvor
im Angesicht
des Todes,
traure nicht
um meinet Willen.
Im Reich der Schatten
dauerte die
liebliche Persephone
mein Schicksal.
Bezirzt von Worten
liebten wir uns
in der Schwärze
des göttlichen Verlieses.
Ihr Mitleid verriet mir
den Weg zum
Licht des Lebens..
Gottes Zorn traf mich,
die Urgestalt
der Freude,
zum zweiten Mal.
In finstrer Nacht
nun rolle ich,
geächteter Rebell,
den Stein
der Erkenntnis
in seinem Auftrag
gegen mich selbst
und die Menschen.
Sie haben sicherlich Sisyphos erkannt. Die Götter haben ihn vergessen.
Er hat es geschafft, sich zeitweise von seinen Qualen zu befreien und macht sich in die Welt auf, nach Menschen zu suchen, die ihm seine Last abnehmen.
Etwa zur gleichen Zeit reitet eine verrottete Reiterschar durch die Wälder auf unsere Stadt zu, angeführt von einem rotbärtigen Herrscher, der sich mit den Gedanken trägt, eine Stadt zu gründen und sie reich zu machen.
Gegen Mittag erreichten die Reiter das Flussufer und suchten nach einer Furt.
Sie ritten am Ufer ostwärts und fanden schließlich vor einer Flussgabel eine Untiefe.
Der Rotbärtige hielt die Reiterschaft an.
„Hier genau werde ich die Pfalz errichten“, sagte er und deutete auf eine Insel,
die von zwei Armen des Flusses umspült wurde. Er war von den Güssen der Nacht stark angeschwollen. „Die Insel erinnert mich an ein Erlebnis aus Thrakien“, fuhr er fort.
„Damals entging ich nach Wolkenbrüchen als einziger mit meinem Zelt den Fluten,
weil ich es auf einer Anhöhe errichtet hatte. Meine Gefährten konnten sich nur mit Mühe retten.“
„Ihr mit Euren Plänen“, sagte der Kanzler.
Erst ein Jahrzehnt nach diesem Gespräch trieben Bauern Eichenpfähle in die Sumpfwiese, das Fundament glanzvoller Tage.
Beim Durchreiten der Furt tauchten die Pferde bis zum Bauch ein. Blut wurde von Stiefeln gewaschen und verlief sich in den Strudeln. Auf der gegenüberliegenden Seite breitete sich eine große Wiese aus, nicht weit von dem Dorf. Dort schlugen die Krieger ihr Lager auf, zündeten Feuer, machten sich über mitgebrachte Speisen und Wein her. Einige badeten im Fluss und wuschen die Strapazen der letzten Wochen von den Körpern und von ihren Wunden.
In der Nacht grölten und tanzten sie betrunken. Eine Horde machte sich auf in das nahe Dorf. Wenig später wimmerten Bauersfrauen, gewaltsam genommen. Rauch zog ins Dorf und in die Hütten der angsterstarrten Bewohner.
Wie könnte sie ein paar Jahre später ausgesehen haben, die Stadt des Kaisers.
Versetzen wir uns einfach einmal in jene Zeit.....
Und so lag hingworfen am satten Weinhang die neue Stadt des Kaisers in der Morgensonne. Nebel zogen über die sumpfigen Wiesen der Talsenke und der Morgentau hinterließ glitzernde Kristalle auf allem Grün. Ein regenreingewaschener Himmel überspannte das Tal und nur ein paar vereinzelte Wolkenberge türmten sich wie graue Felsen im blauen Himmelsmeer.
Modriger Geruch lag in der Luft. Es war der Geruch des Flusses, der sich vermischte mit den Gerüchen der menschlichen Behausungen und Ställe, der Kohlenmeiler und frisch entzündeten Feuer in den Kaminen und vor den Zelten.
Die an den Hang geschmiegten und teilweise mit Lehm verputzten Häuser hatten dem zwei Tage und Nächte dauernden Unwetter nur ungenügend trotzen können. Hier und da hatte der Wind die zum Schutz vor Kälte und Regen angebrachten Häute und Felle in den Fensterluken herausgerissen. Die Lehmfassaden waren noch dunkel vor Nässe und die engen Gassen hatten sich in eine Schlammwüste verwandelt, die nun an der oberen Schicht bereits zu trocknen begann.
In der Talsenke lagen mehrere zerstörte Zelte. Die Besitzer, meist Angehörige des kaiserlichen Gefolges, hatten vor Sturm und Regen die Flucht ergriffen und waren in den Herbergen und Ställen untergekrochen. Hier und da dichteten nun einige Bewohner ihre Unterkünfte notdürftig mit Pech ab.
Allein dem vollkommen aus Stein erbauten Gotteshaus schien der Sturm nicht
ein Haar gekrümmt zu haben, und es hob ungebeugt warnend am Hang die Zeigefinger seiner Türme himmelwärts, zu zeigen den Weg zu einem allmächtigen, dunklen und zürnenden Gott.
Im Oberen Teil der Stadt, in der der Kaiser einen prachtvollen und weithin bekannten Markt geschaffen hatte, passiert dieser Tage Verhängnisvolles.
Eine junge Frau – Anna - gerät unter die Räder eines Karrens und büßt ihre Gehfähigkeit ein. Man bringt sie in ein Haus an der Kreuzung zweier zentraler Handelswege, indem ihr ein seltsamer Mann bald darauf einen schier unglaublichen Handel vorschlägt....
“Beruhigt Euch....verzweifelt nicht.“ Langsam trat Frohwald ans Fenster und drehte ihr den Rücken zu.
“Ihr habt zwar durch diesen schweren Unfall Eure Beweglichkeit eingebüßt und müsst in Eurem weiteren Leben auf vieles verzichten, aber Ihr könnt von mir etwas erhalten,
das kein Mensch dieser Welt besitzt.”
Anna hob langsam ihr tränenüberströmtes Gesicht aus dem Leinen. Sie blickte auf den Rücken Frohwalds und auf die Steine in seinen auf dem Rücken verschränkten Händen.
“Was meint Ihr ?” “Nun,ich bin ein weitgereister Mann und habe viel gesehen ....viel mehr als ihr Euch vorzustellen vermögt. Ich habe dieses Haus erworben wegen seiner Lage.
Wenn Ihr aus diesem Fenster seht, so zieht alles Leben dieser Welt auf diesen beiden Handelsstraßen buchstäblich an Euch vorbei.
All diese Menschen mit der Bürde ihrer Existenz! All ihre Freude, ihre Leiden! Menschliches Dasein in seiner ursprünglichen Form und Vielfalt. Sie alle spielen ihre einzigartige Rolle im Bühnenstück der Götter. Auch Euer Kaiser muss die Aura dieses Ortes gefühlt haben. Und er hat sicher nicht umsonst dieses Plätzchen auserwählt.
Doch das Leben all dieser Menschen hat eine Grenze, nämlich den Tod.
Er ist ihnen allen gewiss! Früher oder später! Seht nur, wie sie eilen,
denn ihr allgegenwärtiger Gegner ist die Zeit! Sie hetzen durch ihr Leben auf der Suche nach allen möglichen Dingen und erkennen doch nie seinen wahren Sinn.
Hört nur, das Treiben dort draußen, Jungfer. Das menschliche Leben ist viel zu kurz, um wirkliche Weisheit und Erkenntnis zu erlangen!” Annas Hände wischten über ihr tränenüberströmtes Gesicht:
“Ihr sprecht in Rätseln! Was ist es, was Ihr mir schenken könntet ?”
“Zeit! Ich könnte Euch Zeit schenken! Unter einer Bedingung....”
“Und die wäre?”
“Ihr dürft dieses Zimmer nie mehr verlassen!”
“Glaubt Ihr, Ihr könnt mich foppen? Wer seid Ihr, dass Ihr einer verunglückten Frau ein solches
Ansinnen antragt?”
Annas Wangen röteten sich und sie hatte sich im Bett aufgesetzt.
Ihr Zorn verrauchte jedoch sofort, als Zedonius Frohwald sich herumdrehte. Den Anflug eines Lächelns auf den Lippen zog er eine der geschwungenen Augenbrauen nach oben und schritt langsam in Richtung ihres Bettes. “Ihr glaubt mir nicht?
Nun, ich bin sehr alt und entstamme einem alten Geschlecht.. Man könnte sagen, die Götter haben mich vergessen, damals. Doch lange schon ziehe ich umher auf der Suche
nach einem weisen Sterblichen, der mir die Bürde des Steines nimmt.”
Zedonius Frohwalds graue Schönheit stand nun vor dem Bette Annas. Er öffnete die Hand und ließ sie die beiden Steinreste sehen:
”Den Stein des Weisheit den Berg hinauf zu rollen ist seit Jahrtausenden mein Schicksal!
Dass er immer wieder in den Abgrund der Unvernunft stürzt, ist Schuld der Menschen.
Doch nun bin ich müde...unendlich müde....“
Zedonius Frohwald blickte fest in Annas Augen:
„Ich bin Sisyphos, der König von Korinth ....“
Eine gnädige Ohnmacht hatte Anna umschlungen, als sie in ihrem Inneren verspürt hatte, dass Frohwald die Wahrheit sagte...Als sie nun erwachte, fand sie sich in seinen Armen wieder. Zedonius Frohwald hielt sie fest, und es war ihr zu ihrer Verwunderung nicht unangenehm. Er hatte seine Arme um sie geschlungen und wiegte sie wie ein kleines Kind. Eine seltsame Ruhe hatte sie erfaßt. Sein Mund war nah an ihrem Ohr: “Habt keine Angst! Ihr werdet unversehrt bleiben über all die Jahre, dafür habe ich gesorgt! Aber ihr werdet mein Zeuge sein....und werdet Bericht erstatten...am Ende...”
Wir erleben nun den ersten Durchreisenden. Es ist unser Kaiser. Wir schreiben den Spätsommer des Jahres 1189. Der Kaiser, der ewige Wanderer ohne festen Wohnsitz wirkt zerbrechlich und müde. Er reflektiert an einem Herbsttag im Jahre 1189 in der Pfalz sein Leben. Er will dem erneuten päpstlichen Aufruf zum Kreuzzug eigentlich nicht mehr folgen ...aber die Staatsraison!
Wer ist dieser Rotbärtige?
Glücksritter
Über Taubenetztes Moos,
Liebkost vom
Ersten Licht
Des neuen Tages,
Ritt ich
Durch Wälder
Sommergrün.
Der Lockruf
Des Zeisigs
Verband sich
In meinem Geist
Mit verlockender
Mächtiger Gier
In finsterer Zeit.
In mir
Kämpften Liebe, Vernunft
Und die Kunst
Gegen Triebe
Und Grausamkeit.
Einsam träumte ich
Im Lotterbett
Der Macht.
Verdarbte Gedanken
Belegten meine Seele.
Das Tal
Weitete sich
Für meine
Kaiserliche Pfalz,
Umspielt von
Klaren Wassern
Des Flusslaufs.
Eine Stadt
Gründete ich
Aus Machtwahn.
Und doch
Liebte ich
Die Gassen
Wie eigene Adern.
In der Kapelle
Zur Zucht erbaut
Nahm ich
Eine Magd auf
Nacktem Sandstein
Und entdeckte
Die Liebe
Des Fleisches.
Das Pendel
Der Geschichte
Erschlug mich
Sanften Krieger
Der Zukunft.
Wir befinden uns im Jahre 1228. Der Kaiser kam vom Kreuzzug nicht mehr zurück.
Die Zeit nach ihm ist von religiösen Phantastereien und politischen Wirren geprägt.
Gottesfurcht schlägt die Menschen in ihren Bann. Eine gewisse Endzeitstimmung greift um sich. Zwei Lichtgestalten streifen in den kommenden Jahrhunderten unsere Stadt. 1228 fährt eine Gottesmagd, eine Braut Christi, auf die Stadttore zu. Sie hat zwei Ziele, Gott zu dienen und den Armen und Siechen zu helfen. Sie sitzt bleich in der Kutsche und betet ohne Unterlaß.
„Geliebter Herr Jesu, heute traf ich die Freude und das Leid auf meiner Reise. Umarme für mich den heiligen Franziskus, den Spender von Freude, Demut und Güte. Nimm ihn in Deine Arme und küsse ihn von mir, seiner getreuen Tochter. Sage ihm, ich traf drei seiner Söhne mit gefrorenen Zehen, aber ihre Augen glänzten wie die bemalten Kirchenfenster von Assisi im Abendlicht. Sie dienen ihm freudig. Beschütze sie, mein geliebter Jesu.
Sorge Dich aber auch um die, die heute Abend gehenkt werden. Vergib ihnen Ungehorsam sowie Raub an Brot und Wurst. Der Älteste tat Unrecht, aber folgte er nicht auch dem Wohle seiner Kinder? Vergib auch dem, der mir an den Busen wollte.
Er begreift die wahre Liebe zwischen Frau und Mann nicht. Erleuchte ihn, mein Herr Jesu.
Wenn Du willst Geliebter, lass uns heute Nacht ein warmes Bett finden bei angenehmen Leuten. Wenn Du aber meinst, wir sollten im Stall nächtigen, so werden wir es geduldig hinnehmen.“
100 Jahre später, genau 1327 taucht ein außergewöhnlicher Mönch, ein Meisterdenker, in unserer Stadt auf. Er wirkt nervös, ist getroffen, weil ihn der Papst wegen seiner Lehren gebannt hat. Sein mystisches Gottes- und Menschenbild wird Grundlage vieler kommender Geister sein. Er ist auf dem Weg nach Avignon, um Rechenschaft abzulegen. Fast hätte er sich in Anna verliebt. Er läßt seine Weisheit in wenigen Sätzen verdichtet an ihrem Fenster zurück.
„Denkt nach über das greichische ‚myein‘ was nichts weniger bedeutet, als in sich einzukehren und sich zu sammeln. Schließt Augen, Ohren und Mund und wendet Euch dem Herzen, Eurem Seelengrund zu. Das bedeutet ‚metanoia‘, Umkehr mit dem ganzen Wesen. Wer dies begreift, braucht keine Angst vor den Folgen zu haben, es wird ein Lichtweg sein, den er beschreitet, auf dem Erfahrung sich in Leben wandelt.
Auf diesem Weg gibt es kein Ziel. Du fließt durch die Zeit in einem Prozess des Menschwerdens.´Auf diesem Weg gibt es nur ein Gebot: gehe nicht nach draußen, gehe nach innen, kehre in Dich selbst zurück, denn in Deinem Inneren wohnt die Wahrheit.
Folgst Du diesem Weg, wirst Du erkennen und Gott in Dich hineinnehmen.
Durch Deine Liebe wirst Du selbst in Gott eingehen. Auf diesem Weg wirst Du auch Kraft für Deine weltlichen Taten finden und diese werden gut sein, weil sie sich aus Gottes Geist speisen, dem Du auf Rastplätzen Deines Weges begegnen wirst.
So erkenne ich drei Grundregeln, die Du beachten musst:
Gehe in die Abgeschiedenheit und wolle nichts; wisse nur um der Erkenntnis willen und nicht der Macht wegen. Vergiss also nicht, was Du weißt, sondern vergiss, dass Du weißt; und schließlich, sei an keinen Besitz gefesselt, lebe in äußerer Armut, so wirst Du reich an Gott und Dir selbst sein.
Für uns heute kaum nachvollziehbar lebten die Menschen in unglaublicher Ehrfurcht vor Gott, die sich hier und dort auch im Wahn äußerte.... Und was ist aus Anna geworden, jenem gelähmten angeblich unsterblichen Geschöpf ? Ist sie wirklich noch da? Hat sich der Zauber des Griechen erfüllt? Tatsächlich! Anna sitzt noch immer dort am Fenster. Die Menschen um sie herum sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie Annas ewige Jugend nicht bemerken. Die Braut Jesu ist ihr begegnet. In der Pfalz halten die Söhne des Rotbärtigen Hof, doch der ursprüngliche Glanz ist verblichen. Die Hoch-Zeiten des Städtchens sind vorüber und neben Existenzkampf und Seinsfragen werden die Menschen in jener Zeit von einer furchtbaren Seuche heimgesucht, die auch diese Stadt nicht verschont.
Als Anna am nächsten Morgen erwachte und sich im Bett aufsetzte, fiel ihr Blick auf den Rücken der Bediensteten. Rosemarie lag auf dem Strohsack und regte sich nicht. Es war kalt. Das Feuer war über Nacht erloschen. Sie rief die Magd bei ihrem Namen, doch diese reagierte nicht.
Mit einiger Kraftanstrengung versuchte sie sich selbst anzukleiden. Wieder einmal verfluchte sie die Taubheit ihres Körpers. Ihre Beine hingen an ihr wie zwei längliche Mehlsäcke. Mit der Kraft ihrer Arme ließ sie sich aus dem Bett gleiten und schob sich zur der Bediensteten hinüber. Sie legte der jungen Frau eine Hand auf die Schulter und versuchte sie auf den Rücken zu drehen. Viel zu leicht gab der junge Körper nach.
Rosmaries Gesicht war übersäht mit bläulichen Verfärbungen. Ihre Zähne schlugen auf einander und auf ihrer fiebrigen Stirn stand Schweiß. Sie war kaum in der Lage die Lider zu öffnen. "Ihr seid krank!" Die blassen Lippen formten kaum hörbar die Worte:
"Der schwarze Tod! Aber...wie kann ich Euch helfen ?"
Verzweifelt blickte Anna die junge Frau an. "Bleibt nur ein wenig bei mir....es dauert nicht lange. Ich werde nach Eurer Familie schicken"
"Lasst ab...es ist niemand mehr da.. sie sind alle tot!"
" Wolltet Ihr deswegen hierbleiben ?"
"Ihr seid immer gut zu mir gewesen und ich habe sonst niemanden."
Anna saß den ganzen Tag neben der Sterbenden. Gegen Abend begann ein Röcheln den Brustkorb der jungen Frau zu erschüttern, so als schlügen innerlich rostige Ketten aneinander. Das Gesicht des Mädchens verfiel immer mehr. Die Knochen traten hervor.
Um die Augen tanzten bereits weiße Irrlichter und doch waren ihre Züge nicht entstellt.
Eine seltsame Ruhe schien sie zu umgeben. Ihr Mund war nicht verzerrt, die Hände lagen blaugeädert und kalt, aber ruhig auf dem Laken.
Und Anna erzählte Rosemarie die Geschichte der Babylonier, welche immer noch ihre Lieblingsgeschichte war. Sie erzählte ihr von jenem Turm, der in den Himmel wachsen wollte, bis Gott schließlich die Dreistigkeit der Menschen mit verschiedenen Sprachen gestraft hatte. Anna sprach in die Dunkelheit des Raumes, in den Äther, nur getröstet durch den Klang ihrer eigenen Stimme, die ein tausendfaches Echo in jener Nacht zu haben schien.
Sie sprach zu Rosemarie von weißen Tauben, von wundersamen Gärten auf schattigem Grund und großen purpurfarbenen Engeln, die durch Lüfte schweben. Die Unwirklichkeit ihrer eigenen Existenz, die sich jenseits aller irdischen Tode befand, holte sie ein, und sie klammerte sich einmal mehr an die Überlieferungen.
Wo befand sie sich - Anna - wenn sie dem Tode nicht anheim fiel und nicht altern konnte?
Ihr Leben kannte keinen Abend und Morgen, keine Tage, Stunden und Monate, nicht Tag noch Nacht - Geist und Mensch zugleich, wandelte sie immerfort zwischen den Welten. Sie - Anna - war die ewige Dämmerung.
Wir befinden uns nun an einem Wendepunkt der Geschichte. Das Mittelalter verblaßt.
Die erleuchtete Steilwand der Zukunft tut sich auf, die Neuzeit kündigt sich an. Der Glanz der Rennaisance läßt die schönen Künste erstrahlen. Ihr Licht verliert sich aber auch auf schwarzer Haut auf Sklavenmärkten und bei der Zerstörung fremder Kulturen jenseits der Weltmeere. 1499 reitet ein schwarzgeklockter Jüngling in die Stadt ein. Neben dem Pferd springt sein Hund, Mephisto. Nicht durchtrieben aber listig will er die Bürgerinnen und Bürger mit schwarzer Magie verführen, ihnen Gold herstellen. Man sagt dem jungen Burschen einen Pakt mit dem Teufel nach Er aber, der Mann der Zeitwende, der Januskopf bezieht sein Wissen aus anderer Quelle. Nach der Veranstaltung verrät er sein Geheimnis einem Mönch.
In der Gaststube ist es ruhiger geworden. Meine Zauberei hat sich herumgesprochen. An den Tischen flüstern sie, blicken ab und zu verstohlen zu mir herüber. Redet und hetzt nur, Ihr Dummköpfe! Mir macht das nichts aus. Der Beutel ist gefüllt, der Magen füllt sich gerade mit Schweinebraten und morgen abend werde ich mir mein Gold von Sieglindes Busen zurückerobern. Das alleine zählt!
Ein Klerikaler tritt zu mir an den Tisch. Wutentbrannt nennt er mich einen Lügner, einen vom Teufel besessenen Scharlatan. Mephisto knurrt unter dem Tisch. Als Hochwürden merkt, ich schere mich nicht um ihn, beruhigt er sich.
„Komm, setz dich, Gottesfürchtiger“, sage ich, „ ich tue dir nichts, also lass auch mich meinen Schweinebraten in Ruhe verzehren. Ich will dir Eines im Vertrauen sagen.“ Dabei ziehe ich ihn am Kragen des heiligen Mantels dicht vor mein Gesicht. „Heute abend, zugegeben, betörte ich die Menschen vielleicht nicht redlich. Aber, das sage ich dir Gottessohn, ich weiß mehr als ihr, die ihr glaubt, gelehrte Geistliche zu sein.
Wenn alles Wissen aller Professoren und Philosophen verloren ginge, ich könnte der Menschheit das Verlorene und noch mehr an Erkenntnis zurückgeben. Kapierst du? Ich hüte ein unglaubliches Geheimnis, das kommt weder von Gott noch vom Satan.
Merk dir das!“
Ich blicke ihm fest in die Augen. Er erliegt mir, wie alle. Ich lasse ihn am Tisch zurück.
In der Gaststube spricht keiner mehr.
Wenig später endlich allein. Die Stube ist spärlich eingerichtet. Nur ein Kreuz verziert die kahlen Wände. Es stört mich nicht. Mephisto hat es sich unter dem Bett gemütlich gemacht. Was sprudelte da in der Gaststube aus mir heraus? Weiß es selbst nicht. Das Buch muss übersetzt werden.
Mein Buch muss etwas wunderbares sein; ein Eldorado des Wissens, ein Konzentrat alles Erdachten. Als ich es einem Professor vorlegte und er sich ein paar Stunden damit befasst hatte, war er blass geworden.
„Nie Gesehenes, nie Gelesenes“, hatte er ausgerufen, „als ob die Welt in den paar Seiten verdichtet ist, ein Werk der Schöpfung“
„Wo hast du das her“ fragte er.
Ich antwortete nicht. Nein, dieses Geheimnis wollte ich für mich behalten.
„Wollt Ihr nun übersetzen oder nicht“, fragte ich ungeduldig, „und für wieviel Geld?“
„Mit Vergnügen“, erwiderte er, „den Preis machen wir später fest. Lass mir das Buch hier, Junge.“
„Nein, noch nicht“, sagte ich, „ich will, dass es das alte Jahrhundert nicht mehr erleuchtet.
Es soll an einem Anfang stehen, jungfräulich, unbeschadet gelesen und verstanden werden.“
Wir sind im Jahre 1525 angelangt. Wieder kommt ein Reisender an. Die neue Zeit geht auch an der Kirche nicht vorbei. Bauernkriege wüten. Die ärmsten der Armen berufen sich bei ihrem Kampf auf einen Kirchenrebellen. Der aber leugnet ihr Recht. In einer stürmischen Gewitternacht plagen ihn in unserer Stadt düstere Träume. Doch morgens ist das Unwetter in seinem Kopf verzogen. Mönche bieten ihm zum Frühstück Bier an. Wir haben ihn den Widersacher genannt.
Ein Gottesblitz
in stürm’scher Nacht
wies mir den
rechten Weg
zum Glauben.
Das weltlich‘ Studium
ließ ich
hinter mir,
verdingte mich
auf grobem
Pflaster kniend
Gottes Wort.
All eitel Tun
legt ab
ich Trunkener
der Einsicht
und trotzte
falscher Päpste
wütend Bannstrahl.
Nicht beug‘
ich mich
den sündig‘
Heuchlern Roms,
noch stolzen Kaisers
mächtig‘ Wort,
auch wenn die
Kutte schweißgetränkt.
Ich widersprech‘
aus Leidenschaft,
steh‘ wie ein Fels
dem Petrus nah
und aus dem Glauben,
der mich nährt,
wächst Neuzeit.
Der Bauern Mordgeschrei
ertrag ich nicht.
Kein Recht als
Gott’s Gebot
genießt der Mob.
Der Obrigkeit
hat Gott
sie anvertraut
zu dienen.
Wer seinen Willen
schändlich achtet nicht,
der schadet sich
und seiner Sache,
versündigt sich
am Herrn
des Himmels und
der Erden.
Die Irrtümer des Glaubens sollten auch in der Stadt am Fluss schreckliche Auswüchse haben. Viele von Ihnen kennen sicherlich die Figuren jener Zeit: den Hexenrichter,
die Pfarrersfrau, die verurteilt und verbrannt wurde. Der Text Scharlachsamt beschäftigt sich auf über 60 Seiten mit jenenbekannten Figuren. Wir aber wollen heute unser Augenmerk auf einen Menschen lenken, der 1642 hier in dieser Stadt lebte und arbeitete. Von ihm ist nur der Name und seine Wohnstätte überliefert, doch er gibt Auskunft über das Ausmaß der Verirrung in jener Zeit.
Als Scharfrichter war er zwar ein angesehener Bürger, doch bei den Weibsbildern stieß er in seinem normalen Leben durchweg auf Ablehnung. Selbst die Huren machten einen Bogen um ihn und wandten sich ab, wenn er an ihnen vorbeiging. Und so hatte er schließlich seine Bemühungen aufgegeben, mit jenen verirrten und geschwätzigen Geschöpfen Kontakt aufzunehmen.
Er hatte es mit den Jahren vorgezogen, seine Zeit in den Herbergen totzuschlagen.
Später dann suchte er die Nähe Gottes. Doch auch hier war er ein Ausgeschlossener:
Er wusste, die Pfaffen würden ihn niemals auf seinen stämmigen krummen Beinen zur Messe lassen.
"Jedes Mal setzte man ihn auf jenen schon morschen Stuhl, den dann einige der kräftigsten Männer in die Kirche trugen, wo man ihn mitsamt dem Schemel an Seilen aufhängte, weil seine Füße den heiligen Boden der Kirche nicht berühren durften.
Vor zwei Jahre hatte eines jener im Gebälk verankerten Seile dem Gewicht nachgegeben
und er war mitsamt dem Stuhl mit lauten Getöse auf den Sandsteinboden gekracht.
Die Pfaffen hatten Zeter und Mordio geschrien und einer hatte vor Schreck den Kelch fallen lassen. Ihr Oberster brach sofort die Messe ab und ließ die zentnerschweren Sandsteinquader entfernen, die er bei dem Sturz berührt hatte.
Baldus verstand den ganzen Aufwand nicht. Früher trieben Bauern bei Unwettern ihre gesamtes Vieh in die Kirche, um es zu schützen. Tags darauf wateten die Kirchenherren durch die zurückgelassenen Exkremente.
Hier und dort verstarb ein Unseliger in den wenigen Bankreihen, in die er sich wie ein weidwundes Reh zurückgezogen hatte und wurde am Tage entfernt und verscharrt. Niemand störte sich daran. Nur er - Baldus Dähler - war ausgeschlossen. War er weniger wert als die Säue und Kälber, die man zum Schutz vor Hagel in das Gotteshaus getrieben hatte?
Doch mit der Zeit hatte ihn in Bezug auf seinen Tagesablauf eine gewisse Gleichgültigkeit ereilt. Seine Tage gingen dahin, teilten sich in Hinrichtungen und Besäufnisse, schlechte Träume, Fressorgien, Schreie geschundener Menschen und Einsamkeit. Er brachte die zu Tode, die Hostien entweiht hatten oder nicht regelmäßig zur Kirche gingen.
Er spannte Diebe und Ketzer aufs Rad, bis ihr Fleisch wie Tintenfischbänder zwischen den Speichen hing. Er pfählte die Weiber, bis ihnen der Pfahl zum Schlüsselbein wieder heraustrat, setzte ihnen die Masken auf und trieb ihnen Nägel durch ihre geschwätzigen Zungen. Aber er verstand nie das Gesetz, nach dem er handelte.
Im Jahre 1665 läuft ein alter Mann, ein Abenteurer, auf die Stadt zu, die er als Kind unter entsetzlichen Umständen verlassen mußte. Er kommt aus dem Süddeutschen. In den Wäldern vor den Stadttoren holen ihn seine Erninnerungen an jene Zeit im dreißigjährigen Krieg wieder ein.
Die Sohlen abgelaufen
Im Staub der
Wüste Mensch
Habe ich Narr.
Tief in mir
Spiegeln sich
Bilder und Zeugnisse
Vergangener Tage
Oder sind’s Schatten
In der Leere?
Soldatenstiefel
Trugen mich
Durchs Leben.
Ich sah das Blut am
Straßenrand versickern,
Das bunte Laub
Auf ausgehauchte
Leiber fallen
Und wagte doch
Zu scherzen.
Als Alter Tölpel erst
Begreife ich
Die Schrecken
Jener Bilder.
Auf meiner Reise
In die Jugend
Gehorcht mein Körper
Nicht mehr
Fremdem Befehl.
Vielmehr klopft
Mein Verstand,
Gewachsen auf
Rauhen Schlachtfeldern,
Nicht Schulbänken,
An die Wand
Der Erinnerungen.
Weg mit den Trugbildern!
Die Schlagader
Des Lebens
Hämmert hinter
Der Fassade.
Tummelt sich
In Kadavern
Nicht neues
Leben zuhauf?
Gebiert nicht Mist
Der Rose Reiz?
Menschenleer könnte
Die Welt sein
Und glänzte doch
Im Licht
Der Schöpfung.
Nicht Macht
und Besitz
Erhebt uns
Über die Erde,
Wie mich fremde
Väter lehrten,
Nur reine Gedanken.
So nehme ich
Die Feder,
Die Lanze
Des Geistes,
Verbeuge mich
Vor mir selbst
Und der Welt
Und schreibe
Mich frei.
Er hat als Kind Entsetzliches erlebt:
„Renn Bub, renn“, rief Großvater, als die Mörderbanden kamen. Ich wollte nicht, aber er schlug mir mit der flachen Hand so kräftig ins Genick, dass ich zu Tode erschrak. Ich raste wie verrückt durch die Gassen, zunächst orientierungslos, dann fiel mir mein Unterschlupf ein. Neben mir taumelten die Menschen, wurden Opfer von Lanzen und Schwertern. An manchen Stellen, musste ich über nackte Leichen springen, rutschte einmal im Blut aus und fiel mit dem Gesicht in den offenen Bauch einer Toten. Es war entsetzlich. Ich begriff nichts, sondern stürmte weiter. Nur raus aus der Stadt. Wie ein Wunder gelang es mir,
zwischen den Reitern durchs Tor zu entwischen. Neben mir schlugen sie einem Jungen den Kopf ab. Dann war ich draußen im Wald, fühlte mich fast sicher. Bald erreichte ich mein Buschnest und blieb wie erstarrt liegen.
Anna Landers, die Frau am Fenster kennt den Mann...
Anna Landers blickte an diesem Tage traurig, auf den vorübergehenden Bäckerssohn. Die Schrecknisse des vergangenen Jahrhunderts hatten die Seelen verbrannt und nur eine zähe schwarze Masse im Innern der Menschen zurückgelassen.
Und doch war in Vereinzelten noch jener Funke, der sie trieb weiterzuleben und Hoffnung zu haben. Etwas an der Haltung des davongehenden Mannes signalisierte ihr, dass er nicht gebrochen war.
Jahre später sollte sie sein Buch in Händen halten. Ein tragikkomisches Wunderwerk,
für dessen Held die deutsche Bevölkerung Tränen der Rührung oder des Lachens vergoss:
Von solcher Komik und Verwirrtheit und doch mit naiver Schläue ausgestattet, reist ein Narr auf unsagbar verschlungenem Lebensweg durch deutsche Lande und quittiert Tod und Teufel und andere Schrecknisse mit dummen Sprüchen.
Nichts aber auch gar nichts schien ihm heilig:
Und doch schien es, als habe jenes Buch eine tiefere Botschaft für die Menschen dieses Jahrhunderts, denen nichts als der Schmerz verblieben war.
In unserer Stadt ist in den letzten Jahrhunderten viel passiert. Man hat Franziskanermönche in Säcken aus der Stadt getragen und in der Burg residierte der erste Sektenführer. Das Rathaus wurde zeitweilig zum Wirtshaus umfunktioniert. Alte Handelswege wurden zu Heerstraßen. Fast zerstört im dreißigjährigen und malträtiert im 7jährigen Krieg blieb die Stadt doch immer ein Augapfel der Mächtigen und Knotenpunkt der Geschichte. Aber genug von Mord und Totschlag, wenden wir uns der hohen Kunst der Literatur zu. 1793 reist ein Dichter, nein ein Dichterfürst durch unsere Stadt. Er trägt einen Brief von Anna und seine Antwort bei sich. Er ist verkatert weil er die letzte Nacht durchgezecht hat. Der Kutscher ein junger intelligenter Bursche verwickelt ihn trotz seines Brummschädels in Gespräche, verhöhnt ihn fast. Und in seinem jämmerlichen Zustand wird der Dichterfürst dem Pferdelenker einfach nicht Herr. Doch dann im Morgengrauen gewinnt unser geistiger Draufgänger kurz vor der Stadt wieder alte Souverenität.
Zunächst: Wer ist er?
Am Ufer
Der Zeit
Sitze ich,
Die Füße
Umspielt von
Vollem Leben.
Sanft weitet sich
Der Horizont
Meiner Gefühle.
Offener Himmel
Verschenkt Licht
An Seerosen
Und gibt
Ideen frei.
Gedanken an
Fernes Mykene
Ziehen vorbei.
Agamemnon verliert
Die Tochter
Im Schatten
Der Geschichte.
Hörst Du mich
Geliebtes Weib?
Ein Wanderer,
unendlich verliebt,
Verfing sich
Im erfüllten Gelb
Deiner Locken.
Tropfen der
Sehnsucht fallen
Ins Ungewisse,
Schwellen an
Zur Flut.
Eine Szene von seiner Anreise in unsere Stadt:
Kaum kann ich es erwarten, meine Stube in der Herberge zu betreten. Der Schauder der Geschichte wird mich überkommen. Dort wo ich nächtigen werde, schlief auch der Teufelsanbeter. In dem Gemach ist er mir bei der letzten Reise so lebendig geworden, dass ich mein ganzes Leben nicht mehr von ihm loskam. Er ruft mich, verfolgt mich.
„Seht, der junge Morgen kämpft gegen die Schatten der Nacht und wird siegen“, sagt der Kutscher. „Ich fahre schon einige Jahre diese Strecke, aber jedesmal bin ich ergriffen, wenn es dämmert. Der Morgen ist die Mutter der Hoffnung, meint Ihr nicht auch?“
„Sehr wahr, junger Mann“, antworte ich angenehm berührt. Und wie so oft fließen mir die Worte auf die Zunge, ohne, dass ich ihnen Einhalt gebieten könnte:
„Der junge Morgen, ist erwacht, Hat von den Schatten sich befreit, Alleine einen großen Sieg errungen. Und aus dem Herzen klingt‘s bedacht: Die Hoffnung, ins Verlies gezwungen, Ist nun vorm Untergang gefeit.“
Als ich ihm das Gedicht vortrage, schaut er mich verdutzt an und zum ersten Mal habe ich Oberwasser, was ich genussvoll auskoste. Mein Vortrag hat ihn so beindruckt, dass er eine Weile schweigt. Mir ist das recht, denn der Schwindel sitzt mir immer noch im Genick und nur langsam klären sich die Sinne auf, eben wie dieser junge Morgen.
Der Weg ist eng an dieser Stelle, schlängelt sich auf einem Hügelrücken dahin. Nasse Zweige schlagen uns hie und da ins Gesicht. Gen Norden auf einer Anhöhe sieht man schemenhaft die Umrisse einer Kirche und vor uns taucht die Silhouette eines Dorfes auf.
Die feuchte Erde auf den Feldern ist dunkelrot.
Mein Begleiter reißt mich aus den Träumen: „Wo lernt man so erzählen und solche schönen Worte reimen?“ fragt er, sichtlich noch von meinen Versen beeindruckt.
„Nur in einem selbst“, antworte ich mit einem fast traurigen Unterton in der Stimme.
Er sieht mich erwartungsvoll an, aber ich sage nichts weiter.
„Sagt“, frage ich, um mich und ihn abzulenken, „Ihr habt doch bestimmt eine junge Frau zuhause, die auf Euch wartet?“
„Was soll ich mich an Eine verschenken, wo ich doch immer unterwegs bin“ antwortet er und hat wieder den verschmitzten Gesichtsausdruck. Er ist schon ein stattlich‘ Kerlchen mit seinen schwarzen Locken, die unter dem Hut hervorfallen, mit seinem sonnengebräunten Gesicht und seinen wachen Augen.
„Manchmal schwärme ich von einem Leben mit Frau und Kind, aber jedes Weib dem ich begegne, belehrt mich eines anderen. Und ich sage Euch, in der Stunde der Begegnung lieben alle gleich. Ihr denkt doch genauso, oder? Die Gestrige war so verliebt in Euch und ich hatte den Eindruck, Ihr seid‘s auch gewesen.“
„Was redet Ihr!“ sage ich gespielt unwirsch. „Solche Abende wie gestern sind mir eher fremd. Ansonsten geht es vornehm und geistig zu.“
„Das glaube ich nicht, dass einer, der solche Worte erdenken und vortragen kann, nicht berauscht lieben kann“, sagt er und trifft mich im Kern.
„Woher wollt Ihr das wissen? Und überhaupt, Ihr sprecht so studiert, warum seid Ihr nicht auf der Universität statt auf dem Kutschbock?“
„Weil ich den jungen Morgen liebe. Wisst Herr, meine Eltern wünschten, dass ich studiere, sie hätten es sich vom Munde abgespart. Aber ich wollte nicht den Himmel gegen eine staubige Studierstube eintauschen. Versteht Ihr? Auf meinen Reisen habe ich genug Zeit zum Denken. Aber in der Universität würde ich mir nur Wissen aneignen, nichts fühlen.“
Wir schreiben das Jahr 1808. Und wenn auch Poesie in jenen Jahren die Herzen ergötzte, so dreht sich doch der immerwährende Reigen der alten Machtspiele weiter. Ein großer Staatsmann und Feldherr, ein wahrer Kriegskünstler“ kommt in der
Stadt an.
Ideen sprudeln,
Reiten mich.
Zu Pferde Vollstrecke ich
Die Kinder
Meiner Phantasie
Im Getöse
Der Schlachtfelder.
Die schönen Künste
Berauschen mich
Wie der Sieg.
Nicht auf Glück
Baue ich Politik,
Meinem Genie,
meiner Intuition,
Vertraue ich.
Kein Tod Rührt mich,
Nur der Tod
Meines Erfolges
Ließe mich zittern.
Millionen folgten
Meinem Ruf,
Millionen opferte
Ich dem Ruhm,
Millionen mögen
Mir verzeihen.
Alles geschah
Zur Ehre Der Nation.
In den nächsten Tagen hat er sich mit einem Disput mit dem Dichter verabredet. In den Händen hält er ein Werk des Dichterfürsten. Er hat es siebenmal gelesen, versteht es aber nicht.
In ein paar Tagen werde ich ihn treffen, den großen deutschen Geist. Ich muss verrückt sein, dass mich die Leiden seines Helden so verunsichern! Bei Gott, es gibt wichtigeres auf dieser Erde als das Seelenleben eines unglücklich Verliebten! Das werde ich ihm eintrichtern, dem Schöngeist. Nein, ein achtes Mal werde ich seinen Erguss nicht lesen.
Soll er mir lieber sein verschrobenes Gedankengewirr erklären. Wegen einer Frau solche Leiden. Ich fasse es nicht! Ich fasse es nicht!
„Wie weit noch zur Stadt, Leutnant?“
„Ein Stündchen Majestät“, antwortet er.
“Fahrt zu, ich bin hungrig.“
„Sehr wohl, Majestät.“
Spanien gibt mir der Schriftsteller nicht zurück. Ich muss mit dem Russen ein Bündnis knüpfen. Soll ich erst mit dem Schöngeist reden oder erst mit dem Zaren? Zuerst mit dem Schöngeist, vielleicht beflügelt es meine Fantasie!
„Verflixt, warum geht es nicht weiter, Leutnant?“
„Pardon Majestät, ein Unfall drei Wagen vor uns, ein Pferd zusammengebrochen.“
„Erschießt es und schafft Ersatz, aber schnell!“
„Die Deichsel brach, es wird ein Weilchen dauern Majestät, entschuldigt.“
„Macht zu und redet nicht!“ brülle ich.
Die Stadt hat auch schon bessere Tage gesehen. Ein großer Kaiser hat sie erbaut, ein großer Kaiser wird seine Notdurft hier verrichten. Was ist Preußen gegen meine Nation? Hauptsache der Braten wird bald gerichtet.
Etwa 100 Jahre nach seiner Zeit, genau 1914, steigt eine gut gekleidete Frau am Bahnhof unserer Stadt aus. Neben all ihrem intelektuellen und politischen Wirken hat sie eine Leidenschaft: Sie sammelt seltene Blumen und preßt sie. In unserer Stadt hofft sie Schildfarn zu finden. Auf dem Weg durch die Stadt - sie hinkt ein wenig - trägt sie nicht nur Gepäck sondern die Last einer großen Verantwortung. Seit Monaten zieht sie durch Deutschland und warnt vor einem drohenden Krieg, der die vergangenen bei weitem an Zerstörungskraft übertreffen wird. Nach ihrer Ansicht ist es ein Krieg der Herrschenden gegen die Völker. Überall sind revolutionäre Geister unterwegs. Auch in unserer Stadt:
Goldstück
Grashalmen im Sturm gleich
Trotze ich Kriegsgeklapper
Der Herrschenden, aber
Am Wankelmut der Freunde
Zerbreche ich - fast.
In den Theorien
Meines Verstandes
Verfängt sich ab und zu
Das süße Leben.
Und im Licht der Verhältnisse
Spiegeln sich verschwommen
Vertraute Bilder in
Der Tiefe Deiner Augen.
Blumen werfen Schatten
An Zellenwände,
Trösten mich Arme in
Zeiten der Dunkelheit.
Der Frühling sendet
Mir trotzigen Mut
Ins Verlies,
leuchtet mir den Weg
Aus der Finsternis.
Geronnene Kraft
Verflüssigt sich
Zum reißenden Strom
Vergessener Gefühle.
Massen schreiten voran
Und die Stärksten
Klopfen an die
Pforten der Macht.
Soldaten sollen ins Feld,
Bejubelte Helden des Untergangs.
Nicht voran, denkt!‘, schreie
Ich in Alpträumen.
Die Schlachtfelder Trojas
Ein Spielplatz
Gegenüber dem,
Was kommen wird.
Ich wählte den Kampf und
Stehe am kalten Wasser nun.
Durch graue Haare weht
Der bittre Wind der Zeit.
Anna, ahnt den Tod der Revolutionärin und denkt über die vergangenen Jahrhunderte nach:
Warum war es so unverständlich für all diese Menschen, dass ihnen ein Dasein im Einklang mit allem Natürlichen beschieden war.... Dass sie ein Teil der Schöpfung und nicht ihr König sein sollten! Dass es eigentlich nichts zu tun gab, als zu lernen an dem was ist und vielleicht jene zu lieben, die sind...
Was hatte die Menschen in diesem Punkte vorangebracht? Welche Könige waren nicht früher oder später Könige über Friedhöfe und Schlachtfelder geworden?
Und welchem Schicksale waren jene entgegengegangen, die sich zwar gegen Kriegsgeheul wehrten, jedoch andere anstachelten?
Von jener Kämpferin der Arbeiterbewegung, die einmal Anna in ihre Arme geschlossen hatte, sollte ein Schuh übrigbleiben. Vielleicht war es der Schuh vom Beine ihrer Behinderung, den ihre Mörder als Trophäe hochhielten. Gefangengenommen trat sie wenig später durch eine Hoteltür und ein Gewehrkolben zerschmetterte ihr den Schädel.
Wir sehen dem Ende des Romans entgegen. Der Rest der Geschichte ist Ihnen geläufig, da sie ihn zum Teil selbst erlebt haben. Anna die Zeitzeugin überlebt auch jene zwei Kriege. Fast neunhundert Jahre alt sitzt sie noch immer an jenem Fenster. In einer Nacht träumt Anna von Sisyphos....
Sie sah ihn im ewigen Eis den Berg hinaufstapften. Der Stein der Erkenntnis war zu einem gigantischen Felsen geworden und er trieb ihn Zentimeter für Zentimeter mit Pflöcken vorwärts. Plötzlich jedoch, als er sich aufrichtete, um zu atmen, löste sich ein Pflock und der Fels rollte über ihn hinweg.
Mit einem Schrei verschwand die dunkle Gestalt unter dem grauen Koloss. Dieser donnerte den Berg hinab, um am Fuße mit einem ohrenbetäubenden Knall in tausend Stücke zu zerbersten. Zerschmettert lag oben am Hang der Grieche im Schnee...
Und dann, als Anna nicht mehr daran glaubt, kommt Sisyphos, alias Zedonius Frohwald, doch zurück. Und mit ihm erscheinen noch andere...
Im Mai dieses Jahres fand ein großer Umzug statt. Man feierte das 830jährige Stadtrecht.
Es war ein sonniger Tag und Anna war gespannt, was sie alles zu sehen bekommen würde. Um aus jenem Festakt ein würdiges Ereignis zu machen, hatte die Stadtverwaltung Gruppen von tschechischen Schauspielern engagiert, die alle Größen darstellen sollten, die im Laufe der Jahrhunderte mit dem Städtchen in Berührung gekommen waren.
In prächtige historische Gewänder gehüllt schritten sie nun umjubelt von den Bürgern durch die ins Mittelalter versetzte Stadt, allen voran der Bürgermeister.
Direkt hinter ihm, in roten Samt gehüllt, kamen von ferne der Kaiser mit dem roten Bart und seine Frau in einer Sänfte. Und wie in den Jahrhunderten zuvor zauberten jene Verkleideten ein Lächeln auf Annas Lippen, wenn sie ein Detail erkannt hatte, das gut gemacht war und Tatsächlichem entsprochen hätte.
Denn noch immer erstanden die Wirklichen – die Richtigen - vor Annas innerem
Auge auf...
Sie beobachtete das Spektakel. Wie immer war er gut getroffen, jener Kaiser, auf den die Bewohner des Städtchens immer besonderen Wert legten. Er hob die Hand zum Gruße und nickte dem Volke zu.
Doch seltsamerweise schien sein Gewand etwas verschlissener zu sein als bei der letzten Feier. Ja, der Samt machte einen völlig anderen Eindruck als der seines Hofstaates. Er hatte eine andere Färbung: Das Rot war intensiver und hatte einen leicht violetten Schimmer. Und doch schien der Stoff nicht von solcher Festigkeit wie der der anderen.
Als er mit seiner Sänfte näher zu ihrem Fenster kam, bemerkte Anna noch eine Merkwürdigkeit: Er trug Schmuck. Goldreifen zuhauf, die sie noch niemals zuvor an einem anderen Darsteller bemerkt hatte.
Auch sein Zepter erschien ihr völlig anders gehalten als in den Jahren zuvor...
Als Annas Augen nun zu seinem Gesicht hochwanderten, hob der Kaiser seinen Kopf etwas und blickte ihr gerade in die Augen. Sein roter Bart leuchtete in der Sonne.
Dies war kein Darsteller! Dort in jener Sänfte saß der Rotbärtige! Der Echte eben!
Erschüttert und mit offenem Munde starrte sie den Vorüberziehenden an. Mit einem leichten Schmunzeln passierte der Kaiser die Frau am Fenster. Später dann drehte er sich noch einmal zu ihr um, hob die Hand und winkte ihr zu.
Fest kniff sie die Augen zu:
„Es ist nicht möglich! Es kann einfach nicht sein.“ Gab es noch andere, die so waren wie sie? Die auch nicht sterben konnten?
Als Anna ihre Augen wieder öffnete, erkannte sie mit Gewissheit:
Dies waren keine tschechischen Schauspieler in romantischer historischer Verkleidung!
Ein paar Meter hinter der Sänfte erkannte sie eine Gestalt aus einer anderen Zeit, die hier in diesem Raum gesessen hatte und sich ihren Fragen gestellt hatte: den Dichterfürsten.
Ja, er war es leibhaftig und zwinkerte ihr zu. Sein wissendes, charmantes Lächeln war ihr in guter Erinnerung: „...seid Ihr nicht verheiratet, meine Teure...?“
Direkt hinter ihm ging Baldus Dähler, jener Unwissende, und dort schritt der Telephonist,
dem kein Hut passte und an seiner Seite die Gottesmagd, gehüllt in weisses Leinen.
Am Ende, wo die Prozession durch Trommler und Pferde begrenzt wurde, ging ein Mann in eisgraues Tuch gehüllt und blickte zu ihrem Fenster herauf.
Sisysphos ist tatsächlich zurückgekehrt. Er stellt die Frage nach dem Erbe der Jahrhunderte und nach der Lernfähigkeit und Weisheit des Menschen. Ich werde Ihnen aber jetzt nicht mehr verraten, was Anna zu sagen hatte, doch glauben Sie mir, dass ihre Worte gehaltvoll waren.